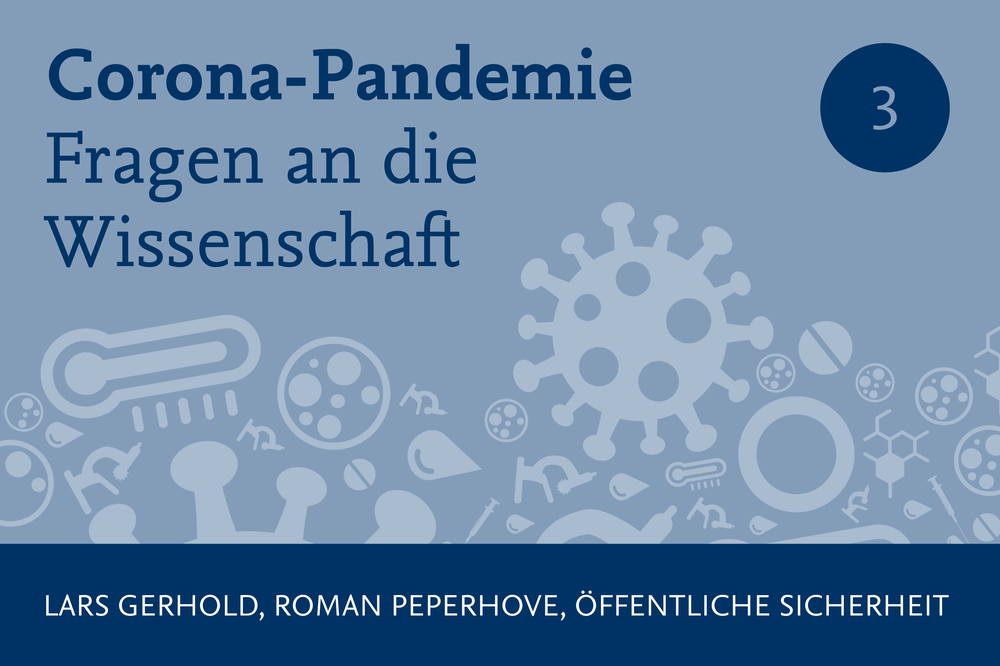„Jeder ist potenziell betroffen – aber jeder kann auch etwas tun“
campus.leben-Serie „Corona – Fragen an die Wissenschaft“ / Teil 3: Interview mit den Sozialwissenschaftlern Lars Gerhold und Roman Peperhove vom Forschungsforum Öffentliche Sicherheit
31.03.2020
Am Forschungsforum Öffentliche Sicherheit wurde gerade eine Umfrage zur Risikowahrnehmung der Menschen in der Corona-Krise und ihren Bewältigungsstrategien erhoben. Professor Lars Gerhold und Roman Peperhove erläutern die Ergebnisse.
Bildquelle: shutterstock.com/khaleddesigner
Zwei Drittel der Deutschen sind wegen der aktuellen Corona-Pandemie beunruhigt – Angst vor einer Infektion hat aber nicht mal jeder Dritte. Im aktuellen Interview der campus.leben-Serie „Corona-Pandemie – Fragen an die Wissenschaft“ erläutern Professor Lars Gerhold und Roman Peperhove vom Forschungsforum Öffentliche Sicherheit der Freien Universität die Ergebnisse einer gerade abgeschlossenen Bevölkerungsstudie. In der neuen campus.leben-Serie blicken Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Freien Universität Berlin aus ihrer jeweiligen fachlichen Perspektive auf die derzeitige Situation.
Herr Professor Gerhold, Herr Peperhove, Sie haben gerade eine Studie abgeschlossen zur Risikowahrnehmung der Menschen in der Corona-Krise und ihren Bewältigungsstrategien – welche Ergebnisse sehen Sie?
Lars Gerhold: In unserer repräsentativen Bevölkerungsstudie können wir beispielsweise zeigen, dass zwar knapp zwei Drittel der Deutschen angeben, sich beunruhigt zu fühlen, aber im Vergleich dazu deutlich weniger Menschen Angst vor einer Infektion haben: nur 28 Prozent. Es macht einen Unterschied, ob man in einer solchen Umfrage auf generelle beziehungsweise diffuse Gefühlslagen fokussiert oder nach konkreter Angst fragt.
Prof. Dr. Lars Gerhold leitet die AG Interdisziplinäre Sicherheitsforschung und ist Projektleiter des Forschungsforums Öffentliche Sicherheit.
Bildquelle: Privat
Angst etwa – das wissen wir aus der Kriminologie – ist etwas sehr Ortsbezogenes: Wir konnten daher auch feststellen, dass sich Menschen derzeit in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln deutlich unsicherer fühlen als in der eigenen Wohnung oder im Freien. Das sind wichtige Erkenntnisse im Hinblick auf die vom Bund und den Ländern verordneten Maßnahmen. Denn die Menschen in Deutschland – auch das zeigen die Ergebnisse – sind sehr problemorientiert. Sie halten sich weitestgehend an die vorgegebenen Einschränkungen, zeigen sich verständig und vertrauen insbesondere den medizinischen Fachexpertinnen und -experten.
Parallel zu dieser Umfrage führen wir eine Studie durch, an der bereits mehr als 250 Expertinnen und Experten von Behörden und Organisationen mit Schutzaufgaben sowie der Sicherheitsforschung teilgenommen haben. Ziel ist es, die Sicht der Bevölkerung mit der der Expertinnen und Experten zu vergleichen.
Ein Schwerpunkt der Arbeit des Forschungsforums Öffentliche Sicherheit ist die Vermittlung von Forschungsergebnissen an Politikerinnen und Politiker – beraten Sie die Politik auch in der derzeitigen Situation?
Roman Peperhove: Ja, wir haben Kontakt zu politischen Entscheidern. Wir stellen einerseits unsere aktuellen Forschungsergebnisse Entscheidern aus Politik und Bevölkerungsschutz zur Verfügung. Außerdem liefern wir auf Anfrage Grundlagen für Entscheidungen, etwa wenn es um das psychosoziale Lagebild in der Bevölkerung geht. Aber wir sind nicht Teil des operativen Krisenmanagements. Das liegt in den Händen der Krisenstäbe bei Bund und Ländern, die mit den Umsetzungsstrukturen viel vertrauter sind als wir. Unsere Aufgabe ist es, wissenschaftliches Wissen zu generieren, aufzubereiten, zu kondensieren und dann zur Verfügung zu stellen. Wir sehen uns als katalytische Wissenschaft.
Wie steht es aus Ihrer Perspektive um die derzeitige Sicherheits- und Versorgungslage in Deutschland?
Gerhold: Die Versorgungslage in Deutschland schätzen wir als sehr gut ein. Sicher gibt es auch mal ein leeres Regal, aber wir gehen nicht davon aus, dass es zu Engpässen kommen wird. Das sagen auch unsere Projektpartner aus dem Logistikbereich. Für die Bevölkerung hingegen mag sich das erstmal komisch anfühlen: In einer durch Just-In-Time-Versorgung-bestimmten Welt nun Sorge haben zu müssen, dass man möglicherweise eben nicht mehr täglich am Supermarkt vorbeigehen sollte – weil man zu Hause besser aufgehoben ist und durch soziale Kontakte auch die Ansteckungswahrscheinlichkeit steigt –, führt zu Verunsicherung.
Die Ergebnisse unserer Studie haben aber gezeigt, dass je nachdem, ob man nach spezifischen Dingen wie Grundnahrungsmitteln fragt oder ganz allgemein nach Lebensmitteln, derzeit etwa 30 bis 40 Prozent der Deutschen mehr einkaufen als üblich. Als wesentliche Gründe geben sie an, nicht mehr täglich einkaufen zu gehen und dennoch für den Fall vorsorgen zu wollen, dass sie in Quarantäne müssen. Und das ist ja plausibel: Wer grundsätzlich zu Hause bleiben muss, kauft bei einem Einkauf mehr ein als üblich, dafür weniger häufig.
Im Vergleich zu einer früheren Studie Neue Strategien der Ernährungsnotfallvorsorge (NeuENV) hat derzeit nach eigenen Angaben etwa die Hälfte der Bevölkerung für zehn Tage vorgesorgt. Vor fünf Jahren war es noch knapp ein Drittel.
Sicherheit schien vor der Corona-Pandemie meistens über Technik gewährleistet werden zu können: über Überwachungskameras oder andere technische Tools. Wie lässt sich in der aktuellen Situation Sicherheit herstellen?
Gerhold: Das ist richtig. Wir haben in den vergangenen Jahren eine Technisierung der Sicherheit erlebt. Aus Effizienz und Effektivitätsgründen wurden alle möglichen Sicherheitsaufgaben an technische Systeme verlagert, insbesondere im polizeilichen Bereich der öffentlichen Sicherheit. Aber auch in der aktuellen Situation spielen Technologien eine wesentliche Rolle, etwa im Monitoring des Pandemie-Verlaufs, in der Sammlung aktueller Daten, in der Verbreitung wissenschaftlicher Ergebnisse. Außerdem gibt es das digitale Unterstützungsprogramm #WirVsVirusHack, über das mehr als 1.500 Miniprojekte in kurzer Zeit entwickelt wurden. Dort wurden digitale Lösungen zum Verteilen von Lebensmitteln, zur Kapazitätsmessung von Krankenhausbetten oder auch für eine effizientere digitale Verwaltung diskutiert.
Und dennoch haben Sie Recht. Im Hinblick auf COVID-19 ist der einzelne Mensch stärker gefragt als die technische Lösung. Jeder ist potenziell betroffen, aber jeder kann auch etwas tun. Soziale Aspekte im Umgang mit Unsicherheit stehen wieder viel mehr im Vordergrund. Auch das zeigen unsere Ergebnisse. Die Befragten zeigen sich problemorientiert, versuchen strukturiert und überlegt zu handeln.
Lassen sich aus der Arbeit des Forschungsforums und Ihren Beobachtungen aus der Studie bereits Empfehlungen ableiten für die Zukunft?
Peperhove: Es werden derzeit drei Eigenschaften in der Bewältigung der Lage deutlich: Erstens basieren politische Entscheidungen – in großen Teilen – auf virologischen und epidemiologischen Überlegungen und Studien. Dieser Blick auf die Wissenschaft und das Einbeziehen der Wissenschaft in gesellschaftliche und politische Entscheidungen sollte auch in Zukunft beibehalten werden. Das Forschungsforum Öffentliche Sicherheit versucht unter anderem über das direkt neben dem Deutschen Bundestag angesiedelte Future Security Lab den Wissenstransfer zur Politik und zu Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben zu erleichtern. Hierzu gehören Vertreterinnen und Vertreter von Bundes- und Landesministerien, etwa des Inneren oder der Bildung, ebenso wie die Spitzen von Organisationen, etwa dem Technischen Hilfswerk oder der Feuerwehr.
Zweitens gibt es eine sehr starke Zentrierung auf die medizinische Herausforderung. Krisen und Katastrophen sind jedoch komplex und dynamisch. Daher wird erst jetzt langsam der Ruf nach einer Evaluation der politischen Maßnahmen und einer ganzheitlichen Bewertung der Lage lauter, die die sozialen und psychischen Aspekte der Menschen in Quarantäne und Isolation mitberücksichtigt. Das war auch die Motivation für die von uns durchgeführte Studie.
Und ein dritter und letzter Punkt: Auch die Sicherheit und die Sicherheitsforschung unterliegen thematischen Schwankungen mit begrenzter Aufmerksamkeit. Das Thema Pandemie war nach dem Ausbruch des SARS-Virus im Jahr 2003 mit damals etwa 800 Toten vor allem in Asien einige Zeit auf einem hohen Aufmerksamkeitsniveau. Solche Aufmerksamkeiten verschwinden aber mit dem Abklingen des Ereignisses.
Es ist auch an uns Wissenschaftlern, gemeinsam mit Behörden und Organisationen, die Sicherheitsaufgaben haben, darauf zu dringen, dass Themen und Bedrohungen nicht vergessen werden und dass wir uns für unterschiedliche Szenarien wappnen sollten. Ansätze der Zukunftsforschung können die Sicherheitsforschung hier deutlich weiterbringen. Hierzu gehören beispielsweise die Szenariotechnik, das sogenannte Horizon Scanning oder generell Methoden der Vorausschau, die eine Strategieentwicklung für mögliche zukünftige Risiken ermöglichen. Im Forschungsforum Öffentliche Sicherheit bearbeiten wir diesen Schwerpunkt unter dem Begriff „Security Foresight“.
Die Fragen stellte Christine Boldt
Weitere Informationen
Lesen Sie alle Interviews der campus.leben-Serie „Corona – Fragen an die Wissenschaft“:
- Prof. Dr. Claudia Müller-Birn: „Wie können wir die Tracing-App gestalten, damit sie auch genutzt wird?“
- Prof. Dr. Tanja Börzel: „Die EU hat in Krisen Resilienz bewiesen“
- Prof. Dr. Eun-Jeung Lee: "Inzwischen versuchen viele Länder, aus den koreanischen Erfahrungen zu lernen"
- Prof. Dr. Joachim Trebbe: „Wir kommunizieren mehr als sonst in Blasen“
- Prof. Dr. Stefan Gosepath: Wie gerecht ist unsere Gesellschaft in der Krise?
- Dr. Carolin Auschra: „Organisationen und Systeme verändern sich oft in Zeiten großer Krisen“
- Prof. Dr. Hansjörg Dilger: „Corona ist ein Spiegel der Globalisierung und der durch sie verursachten Ungleichheiten“
- Prof. Dr. Lars Gerhold und Roman Peperhove: „Jeder ist potenziell betroffen – aber jeder kann auch etwas tun“
- Prof. Dr. Paul Nolte: „Wir werden jahrzehntelang an diesem Trauma zu knacken haben“
- Prof. Dr. Martin Voss: „Wo wir es wollen, können wir ganz fundamentale Weichen für die Zukunft stellen“
Englische Übersetzungen:
- Interview with Claudia Müller-Birn: “How should we design the tracing app so that people want to use it?”
- Interview with Tanja Börzel: “The European Union has proven its resilience in times of crisis”
- Interview with Professor Eun-Jeung Lee: “Many countries are now trying to learn from the Korean experience”
- Interview with Professor Joachim Trebbe: “We are communicating more than usual in bubbles”
- Interview with Stefan Gosepath: How Just is Our Society in Times of Crisis?
- Interview with Carolin Auschra: “Organizations and systems often change in times of great crisis”
- Interview with Professor Hansjörg Dilger: “The coronavirus pandemic is a mirror of globalization and the inequalities it has produced”
- Interview with Lars Gerhold and Roman Peperhove: “Everyone is potentially affected, but everyone can also do something”
- Interview with Paul Nolte: “We are going to be working through this trauma for decades to come”
- Interview with Martin Voss: “If we choose to, we can lay the groundwork to shape the future”