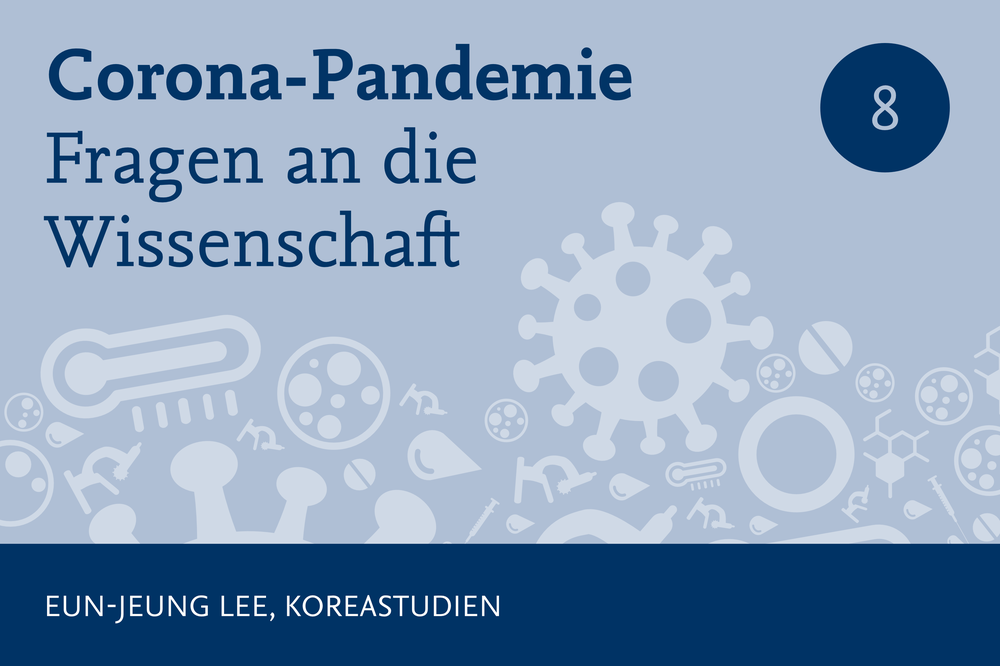„Inzwischen versuchen viele Länder, aus den koreanischen Erfahrungen zu lernen“
campus.leben-Serie „Corona – Fragen an die Wissenschaft“ / Teil 8: Interview mit Professorin Eun-Jeung Lee, Leiterin des Instituts für Koreastudien der Freien Universität Berlin
23.04.2020
Wegen der Erfahrungen mit früheren Epidemien wie SARS und MERS sei Südekorea besser auf die Coronavirus-Pandemie vorbereitet gewesen als europäische Länder, sagt die Koreanistin Prof. Dr. Eun-Jeung Lee.
Bildquelle: shutterstock.com/khaleddesigner
Was verändert sich durch die Corona-Pandemie? Welche Folgen hat sie für das Leben jedes Einzelnen, welche Auswirkungen auf die Gesellschaft, die Politik, die Wirtschaft, die Kultur? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Freien Universität Berlin blicken in der campus.leben-Serie „Corona – Fragen an die Wissenschaft“ aus ihrer jeweiligen fachlichen Perspektive auf die derzeitige Situation: Im aktuellen Interview sprach Raphael Rönn mit Professorin Eun-Jeung Lee, Leiterin des Instituts für Koreastudien der Freien Universität, über die Erfolge Südkoreas bei der Eindämmung des Virus und über die Lage in Nordkorea.
Frau Professorin Lee, die Zahl der SARS-CoV-2-Infektionen in Südkorea ist bemerkenswert niedrig. Wie ist es den Koreanerinnen und Koreanern gelungen gegenzusteuern?
Prof. Dr. Eun-Jeung Lee leitet das Institut für Koreastudien der Freien Universität Berlin.
Bildquelle: Ludwig Niethammer
Die Koreaner haben es noch nicht geschafft, das Virus vollkommen einzudämmen, aber zumindest die Ausbreitung deutlich zu verlangsamen. Dafür gibt es mehrere Gründe: schnelle und umfangreiche Infektionstests, gründliche Desinfektion – in einem Ausmaß, das man sich hier gar nicht vorstellen kann – sowie konsequente Maßnahmen zur Einhaltung des physischen Abstands zwischen Menschen.
Zunächst zu den schnellen und umfangreichen Tests: Die südkoreanische Regierung hat sehr früh das Risiko einer massiven Ausbreitung von Corona-Infektionen erkannt und gleich ein umfangreiches Testsystem aufgebaut. Sobald eine Person positiv getestet wird, werden ihre Bewegungen im öffentlichen Raum rekonstruiert. Kontaktpersonen werden umgehend informiert und getestet. Dabei nutzt man die bei Kartenzahlungen erfassten Daten, außerdem eine spezielle Smartphone App.
In Deutschland und Europa hat man wegen des Datenschutzes Bedenken, solche Apps einzusetzen. Meiner Ansicht nach wäre unter Wahrung der Datenschutzstandards technisch vieles möglich. Es wird auch hierzulande nicht mehr bestritten, dass die schnellen und präzisen Tests der erste wichtige Schritt bei der Bekämpfung der Seuche überhaupt sind.
Zum zweiten wichtigen Aspekt: die gründliche Desinfektion, die vor allem zur Vorbeugung wichtig ist. Dass man sich häufig die Hände waschen und sich nicht ins Gesicht fassen soll, ist quasi in die DNA der Koreaner übergegangen. Aber noch wichtiger ist, dass alle Orte, an denen sich eine positiv getestete Person aufgehalten hat, gründlich desinfiziert werden, sei es ein Hotel, ein Restaurant oder ein Geschäft. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel werden nicht nur gereinigt, sondern gründlich desinfiziert. Das ist eine logistisch eindrucksvolle Leistung der Gesundheitsbehörden.
Und der dritte Punkt: die physische Distanz, also Abstand halten – dazu gehören die Selbstquarantäne und zum anderen das Tragen von Mundschutzmasken. In Südkorea oder auch in Ostasien gehören sie schon lange zum Alltag. Auch wenn nicht sicher ist, wie stark man sich selbst damit schützt: Sicher ist, dass man andere schützt.
In Südkorea trägt man ganz selbstverständlich Maske, wenn man erkältet ist und dennoch aus dem Haus gehen muss. Was die Selbstquarantäne angeht: In Südkorea dürfen Infizierte und mit Infizierten in Kontakt-Gekommene 14 Tage lang gar nicht ihre Wohnung oder ihr Haus verlassen – nicht einmal, um den Müll hinauszubringen. Während der Quarantäne ist es strikt verboten, mit anderen Personen in Kontakt zu kommen, selbst mit möglichen Mitbewohnern.
All diese Maßnahmen, die ganz konsequent ausgeführt wurden, haben dazu beigetragen, dass die Kurve der Infektionszahlen schon im Februar nur langsam, nicht exponentiell angestiegen ist.
Waren die koreanische Regierung und die Gesellschaft besser auf die COVID-19-Pandemie vorbereitet war als Deutschland und Europa?
Ja. Aufgrund der Erfahrungen mit früheren Epidemien wie SARS und MERS hat die koreanische Regierung systematisch einen Pandemieplan entwickelt. Bereits im Januar, als der erste COVID-19-Fall auftrat, ist man aktiv geworden und hat Maßnahmen ergriffen. So konnte die Regierung bis Mitte Februar die Zahl der Infektionen in Korea sehr niedrighalten. Die Zahl stieg dann im Zusammenhang mit einer christlichen Sekte stark an: Bei einem Gottesdienst haben sich viele Menschen angesteckt und die Infektion in ihr Umfeld getragen.
Die südkoreanische Regierung hat seitdem viel unternommen und ist den Empfehlungen der WHO gefolgt. Die Leiterin des koreanischen Pendants zum Robert-Koch-Institut ist die zentrale Akteurin – sie hat das Mandat, die Maßnahmen durchzusetzen. Die koreanische Regierung agiert unter ihrer Regie. Das Vertrauen in die Regierung ist sehr groß.
Wie verlaufen in Südkorea die Diskussionen darüber, wann und wie sich das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben wieder normalisieren könnte?
In Südkorea gab es bisher keinen Shutdown. Das normale Geschäftsleben ist allerdings beeinträchtigt. Es erweist sich als großes Problem, dass Korea – genau wie Deutschland – sehr stark von Exporten und der Weltwirtschaft abhängig ist. Das hat auch Einfluss auf den Konsum im Inland. Südkorea hat einen sehr großen Anteil an Selbstständigen, es gibt viele kleine Betriebe und Einzelhändler. Sie alle sind stark von der Krise betroffen. Die Regierung sucht nach einer Lösung, aber von einer Normalisierung kann noch lange nicht gesprochen werden.
Könnten die Maßnahmen, die Sie beschrieben haben, als Vorbild für Deutschland und Europa dienen?
Ich sehe keine Maßnahme, die nicht auch in Deutschland und Europa konsequent umgesetzt werden könnte. Manche behaupten zwar, die konfuzianische Kultur Koreas sei der Grund für den Erfolg bei der Bekämpfung von COVID-19, weshalb Europa nicht von Korea lernen könne. Ich kann dazu nur sagen, dass man den armen Konfuzius in seinem Grab lassen und nicht jedes Mal herausholen sollte, wenn es um Ostasien geht. Es hilft jedenfalls nicht weiter. Inzwischen versuchen allerdings viele Länder, aus den koreanischen Erfahrungen zu lernen.
Wir haben über die Maßnahmen gegen die Pandemie in Südkorea gesprochen. Wie sieht die Situation in Nordkorea aus? Dringen Informationen nach außen? Wie würden Sie das Risiko für das politisch isolierte Land einschätzen?
Nordkorea hat sich bereits im Januar so gut wie vollständig abgeschottet. Alle Rückkehrer werden seitdem erst einmal unter 40-tägige Quarantäne gestellt. Viele Nordkorea-Experten gehen davon aus, dass Nordkorea aufgrund des Mangels an medizinischer Ausstattung und Medikamenten – ein Mangel, der nicht zuletzt eine Folge der harten internationalen Sanktionen ist – Schwierigkeit haben würde, eine Pandemie, wie sie durch COVID-19 verursacht wird, ohne totale Abschottung einzudämmen. Die einzige Möglichkeit bestehe darin, die Grenzen zu schließen.
Wir haben keine verlässlichen Informationen über die wirkliche Lage in Nordkorea. Wir können nur hoffen, dass es zu keiner Katastrophe kommt und dass die Nordkoreaner die Pandemie gut überstehen. Den Studierenden von der Kim-Il-Sung-Universität in Pjöngjang, die im Januar in Berlin waren und am FUBiS-Programm der Freien Universität teilgenommen haben, soll es gut gehen.
Die Fragen stellte Raphael Rönn
Weitere Informationen
Lesen Sie alle Interviews der campus.leben-Serie „Corona – Fragen an die Wissenschaft“:
- Prof. Dr. Claudia Müller-Birn: „Wie können wir die Tracing-App gestalten, damit sie auch genutzt wird?“
- Prof. Dr. Tanja Börzel: „Die EU hat in Krisen Resilienz bewiesen“
- Prof. Dr. Eun-Jeung Lee: "Inzwischen versuchen viele Länder, aus den koreanischen Erfahrungen zu lernen"
- Prof. Dr. Joachim Trebbe: „Wir kommunizieren mehr als sonst in Blasen“
- Prof. Dr. Stefan Gosepath: Wie gerecht ist unsere Gesellschaft in der Krise?
- Dr. Carolin Auschra: „Organisationen und Systeme verändern sich oft in Zeiten großer Krisen“
- Prof. Dr. Hansjörg Dilger: „Corona ist ein Spiegel der Globalisierung und der durch sie verursachten Ungleichheiten“
- Prof. Dr. Lars Gerhold und Roman Peperhove: „Jeder ist potenziell betroffen – aber jeder kann auch etwas tun“
- Prof. Dr. Paul Nolte: „Wir werden jahrzehntelang an diesem Trauma zu knacken haben“
- Prof. Dr. Martin Voss: „Wo wir es wollen, können wir ganz fundamentale Weichen für die Zukunft stellen“
Englische Übersetzungen:
- Interview with Claudia Müller-Birn: “How should we design the tracing app so that people want to use it?”
- Interview with Tanja Börzel: “The European Union has proven its resilience in times of crisis”
- Interview with Professor Joachim Trebbe: “We are communicating more than usual in bubbles”
- Interview with Stefan Gosepath: How Just is Our Society in Times of Crisis?
- Interview with Carolin Auschra: “Organizations and systems often change in times of great crisis”
- Interview with Professor Hansjörg Dilger: “The coronavirus pandemic is a mirror of globalization and the inequalities it has produced”
- Interview with Lars Gerhold and Roman Peperhove: “Everyone is potentially affected, but everyone can also do something”
- Interview with Paul Nolte: “We are going to be working through this trauma for decades to come”
- Interview with Martin Voss: “If we choose to, we can lay the groundwork to shape the future”